In Kooperation mit dem Surveillance Studies Blog veröffentlicht Criminologia Rezensionen von Büchern aus den Bereichen Überwachung & Kontrolle und Kriminologie. Weitere Rezensionen finden sich hier.
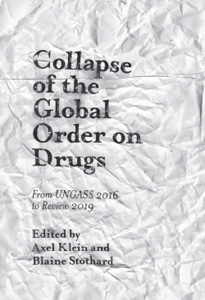 |
Titel: | Collapse of the Global Order on Drugs: From UNGASS 2016 to Review 2019 |
| Herausgeber: | Axel Klein & Blaine Stothard | |
| Jahr: | 2018 | |
| Verlag: | Emerald Publishing | |
| ISBN: | 9781787564886 |
Die aus christlich-fundamentalistischem Eifer zu Beginn des 20. Jahrhunderts geborene globale Drogenordnung, deren beginnender Zusammenbruch hier in 14 Kapiteln (sowie einer lesenswerten Einleitung und einem ebenfalls inspirierenden Epilog) von großenteils hervorragenden Fachleuten beschrieben und analysiert wird, sollte einerseits auf der ganzen Welt die Versorgung von Patienten mit wichtigen Arzneimitteln sicherstellen, andererseits aber auch jeden Missbrauch dieser Stoffe mit allen Mitteln verhindern. Dabei war (und ist) es von entscheidender Bedeutung, dass das globale Drogenrecht (bis heute) jeden Gebrauch als Missbrauch etikettiert, der nicht den Zwecken der Medizin oder der Wissenschaft dient – also den desorganisierten ebenso wie den kontrollierten Heroinkonsum, die spirituelle Ayahuasca-Erfahrung ebenso wie den gelegentlichen Zug aus dem Vaporizer oder die Einnahme der einen oder anderen Partypille am Wochenende.
Geschafft hat die globale Drogenordnung allerdings weder das eine noch das andere. Zu sagen, dass der Effekt des globalen Prohibitions-Regimes gleich Null war, wäre allerdings noch geschmeichelt, weil es das millionenfache Leiden unterschlüge, das der Kreuzzug für eine drug-free world zur Folge hatte und immer noch hat. Millionenfach klingt zwar arg nach Dramatisierung, ist aber eher untertrieben, wenn man bedenkt, dass diese sogenannte Drogenordnung dafür gesorgt hat, dass Milliarden Menschen – nämlich rund 80% der Weltbevölkerung – unter einem access abyss in palliative care and pain relief leidet, also einer unnötigen Unterversorgung in Palliativmedizin und Schmerzbehandlung, wie Katherine Pettus (85 ff.) in einem der besonders lesenswerten Beiträge dieses Sammelbandes mitteilt, und wenn man zweitens weiß, wie viele Familien durch die gesellschaftliche Ächtung und juristische Verfolgung von Menschen, die mit Drogen zu tun haben, zerstört werden – von Schulverweisen und Inhaftierungen, von Drogenkriegen wie in Mexiko oder blutigen Anti-Drogen-Kampagnen wie derzeit auf den Philippinen.
Während sich zu diesem zweiten Aspekt leider nur Fragmente finden – vor allem in den Beiträgen über die Todesstrafe für Drogendelikte, aber auch in denen über die jeweiligen Bekämpfungs-Strategien in Russland, Südostasien, den islamischen Staaten (133 ff.) und den USA (251 ff.) – liegt der Schwerpunkt des Werkes auf der Frage, wie Akteure der Zivilgesellschaft die schwerfällige UN-Drogen-Bürokratie für harm reduction, bzw. den Übergang von der Prohibition zur Regulation (vor allem bei Cannabis: 101 ff., 191 ff.) erwärmen könnten.
Dafür wird ein Blick zurück auf die drogenpolitischen UN-Wegmarken in den Jahren 1998, 2009 und 2016 geworfen und eine vorsichtig positive Bilanz gezogen. Der United Nations General Assembly Special Session (UNGASS), die 2016 eigens zur Drogenfrage einberufen worden war, wird zugutegehalten, dass sie die Tür zu einer globalen Diskussion geöffnet habe, die immerhin Konflikte und damit auch Fortschritte ermöglicht. Ausgetragen werden diese Konflikte vor allem in der Suchtstoffkommission der UNO, also der in einschlägigen Kreisen als CND bekannten Commission on Narcotic Drugs, die in der Weltorganisation über eine Art drogenpolitischer Richtlinienkompetenz verfügt.
Während ich gerade dieses Besprechung verfasse, diskutiert ebendiese CND auf ihrer 62. Sitzung (18.-22. März 2019) in Wien im Rahmen eines Review-Verfahrens über das, was seit 2009 (und 2016) erreicht und nicht erreicht wurde und wo vielleicht Neujustierungen erforderlich sein könnten. Allein das ist für dieses spezielle Gremium schon ein Fortschritt. Hinzu kommt aber als entscheidender Faktor, dass die Kommission sich bei diesem Review nicht in Plattitüden flüchten kann, weil sie erstmals unter kritischer Beobachtung durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen und die Leiter anderer UN-Organisationen steht, die allesamt geneigt sind, die Wiener Drogen-Bekämpfer an die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und die UN-Ziele einer nachhaltigen Entwicklung heranzuführen.
Das wird ein weiter Weg werden. Aber als die CND-Mitglieder am Montag dieser Woche zu Tagungsbeginn zusammenkamen, hatten sie in ihren Unterlagen schon den Bericht des UN system coordination Task Team on the Implementation of the UN System Common Position on drug-related matters. Darin ging es unter dem Titel What we have learned over the last ten years: A summary of knowledge acquired and produced by the UN system on drug-related matters (March 2019) um genau diese Botschaft: auch die Drogenpolitik des Wiener UNO-Büros hat sich an die allgemeinen Prinzipien der UNO zu halten. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, war es aber realiter aus historischen und politischen Gründen nie gewesen (die Drogen-Bekämpfungs-Bürokratie ist viel älter als die UNO und sogar älter als der Völkerbund und hat sich nie von ihrer ganz anders gearteten Orientierung abbringen lassen). Wenn alles gut geht, tragen aber Publikationen wie die hier besprochene und wie der neue Bericht dieses Task Teams dazu bei, dass es in Zukunft einmal so sein wird.