In Kooperation mit dem Surveillance Studies Blog veröffentlicht Criminologia Rezensionen von Büchern aus den Bereichen Überwachung & Kontrolle und Kriminologie. Weitere Rezensionen finden sich hier.
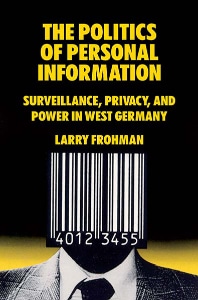 |
Titel: | The Politics of Personal Information. Surveillance, Privacy, and Power in West Germany |
| Autor: | Larry Frohman | |
| Jahr: | 2021 | |
| Verlag: | Berghahn (New York/Oxford) | |
| ISBN: | 9781789209464 |
Die Geschichte des deutschen Datenschutzes und Datenschutzrechts ist angesichts der DSGVO abgeschlossen, scheinbar auserzählt, hinter 1970 zurück jedoch auch noch weitgehend unerforscht. Ein Blick zurück in und vor die Anfangszeiten des Datenschutzrechts lohnt, um unter die heute durch das europäische Grundrecht auf Datenschutz (Art. 8 GRCh) auf eine (zu) einfache Formel gebrachte Entwicklung und Diskussion zu schauen. Denn hinter einem solchen Begriff – dasselbe gilt für dogmatische Großformeln wie dem „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ – verbergen sich politische Kompromisse, unterschiedliche theoretische Konzepte und dogmatische Alternativen. Da das deutsche Datenschutzrecht ganz maßgeblich an der Wiege des europäischen Datenschutzrechts Pate stand, ist ein Blick in die deutsche Datenschutzgeschichte auch für das Verständnis des europäischen Datenschutzrechts und kommender Überwachungsherausforderungen hilfreich.
Hierzu hat der amerikanische Historiker Lawrence Frohman (Stony Brook), dessen Hauptarbeitsgebiet die deutsche Sozial- und Informationsgeschichte ist, eine umfangreiche Studie vorgelegt. Sie widmet sich hauptsächlich der Entstehung des deutschen Datenschutzrechts bis etwa 1990, daneben speziell den Auswirkungen hiervon auf das deutsche System innerer Sicherheit. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Vorangestellt ist ein Einführung, die den Gang der Darstellung vorstellt und auch schon als Zusammenfassung gelesen werden kann.
In der Introduction und in Part 1 (mit seinem einzigen Chapter 1) wird das Entstehen des deutschen Meldewesens (nach dem II. Weltkrieg) und deren zunächst technikoptimistische Entwicklungsrichtung beschrieben bis hin zu dem/n Kipppunkt(en) um 1970 herum sowie den folgenden Jahren, die dann im Melderegisterrahmengesetz (MRRG) von 1980 ihren (vorläufigen) Abschluss fand.
Part 2 beschreibt zunächst das Entstehen und weitere Werden des Datenschutzrechts auf Bundesebene, also das des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Im Chapter 2 werden die ideengeschichtlichen – Juristen würden sagen: dogmatischen – Grundlagen des (späteren) Datenschutzrechts aufgezeigt, insbesondere die Kritik an Sphärenvorstellungen, und der spezifische würdebasierte Ansatz (vgl. Art. 1 Abs. 1 GG). Chapter 3 zeichnet die rechtspolitische Diskussion um das BDSG nach; hier ist die Arbeit eine gute Ergänzung der Arbeit von Werner Liedtke (Das Bundesdatenschutzgesetz. Fallstudie zum Gesetzgebungsprozess, 1980), der vornehmlich den eigentlichen parlamentarischen Gesetzgebungsprozess beschreibt. Unverzichtbar für das Verständnis der deutschen Datenschutzkultur ist die Protestbewegung gegen die für 1983 geplante und dann 1987 durchgeführte Volkszählung in Chapter 4. Chapter 5 handelt dann davon, wie die Datenschutzdiskussion (zusammen mit den Grünen) dann wieder in das Parlament zurückgekehrt und zu der Novellierung des BDSG von 1990 führte.
Dann macht das Buch einen Schwenk bzw. nimmt eine thematische Verengung vor, wenn es sich die Auswirkungen dieses deutschen Datenschutzrechts auf die Sicherheitsbehörden vornimmt. Kundig und auch für Kenner der Surveillance Studies in vielen Aspekten interessant sind die Kapitel zur informationellen Polizeiarbeit vor dem Computerzeitalter (Chapter 6), zur ansteigenden Bedeutung der zunehmenden Verdatung von Polizeiarbeit (Chapter 7), zu dem Quantensprung, der in diesem Bereich durch die Fahndung nach der RAF und der Durchleuchtung ihres Umfelds unter v.a. Horst Herold erfolgte (Chapter 8), und schließlich zur Reform des Datenschutzrechts bei den Sicherheitsbehörden nach dem Volkszählungsurteil von 1983 (Chapter 9).
Unzweifelhaft und auch nicht überraschend für das Werk eines Sozialgeschichtlers liegt der Wert der Arbeit zum einen darin, dass die Geschichte (der Entstehung) des (deutschen) Datenschutzrechts in einer Tiefe und Breite zusammengefasst wird, die es bislang so noch nicht gab; auf das insoweit beschränkte Werk von Liedtke ist bereits hingewiesen worden. Jedenfalls reicht das Buch weit über die geschichtlichen Abrisse in den Gesetzeskommentaren und Datenschutzlehrbüchern hinaus. Der Gewinn für den Datenschutzrechtler und (noch mehr) den Datenschutzpraktiker ist, sich der unterkomplexen Konzeption und dünnen theoretischen Basis des Datenschutzrechts und auch seiner verfassungsrechtlichen Grundlegungen bewusst zu werden. Denn die grundrechtliche, also subjektiv gedachte Konzeption eines „Rechts auf informationelle Selbstbestimmung“ kann die strukturellen Aspekte von Informationssystemen und Überwachungsinfrastrukturen nur unvollkommen abbilden. Dass die Datenschutzbeauftragten hier als mehr oder minder gut funktionierendes Scharnier fungieren, hätte in der Darstellung vielleicht noch stärker betont werden können. Für die an den Surveillance Studies Interessierten bietet das Buch darüber hinaus noch eine spezifische Studie zu der Aus- und Einwirkung des (frühen) Datenschutzrechts auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden.
Das Buch von Larry Frohman ist, wie von angelsächsischen Akademikern nicht anders zu erwarten, angenehm zu lesen. Selbst ein penibler Jurist findet nur minimale rechtliche und rechtsgeschichtliche Ungenauigkeiten (Volkszählungsgesetz als erstes vom BVerfG verworfenes Gesetz [S. 16]; teilweise Gleichsetzung von Meldeämtern und Bürgerbüros [S. 59]), die beim Arbeiten in fremder Sprache und fremder Rechtsordnung wohl unvermeidlich sind. Wer sich nicht so sehr für die Geschichte und Tätigkeit der Sicherheitsbehörden interessiert, kann den Part 3 auch einfach nur querlesen oder überblättern.
Mit dem Buch hat die deutsche Datenschutzgeschichte einen dicken Schlussstein bekommen. Dass es kein Grabstein ist, sehen wir an der Fortentwicklung des deutschen Datenschutzrechts auf der europäischen Ebene. Sich der konzeptionellen Diskussionen und Theoriedebatten aus den Anfangszeiten zu erinnern, kann nicht schaden, denn diese sind nicht spezifisch deutsch, sondern vielleicht nur in spezifisch deutscher Weise hierzulande in den 1970ern und 1980ern ausgetragen worden. Ein Blick von gleichzeitig außen (aus den USA) und von innen (aus den damaligen politischen Diskussionen heraus) kann für die Zukunft des Datenschutzes nur hilfreich sein.