Allgemeines und Gestaltung
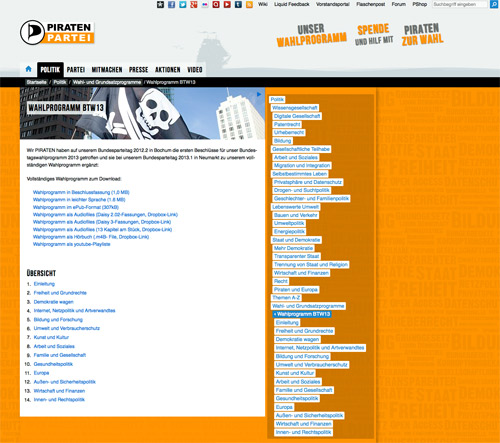
Das „Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013“ der Piratenpartei Deutschland ist mit „Wir stellen das mal infrage“ betitelt und besteht in der 166 Seiten starken pdf-Version (Größe: 1,05 MB)1. Darüber hinaus liegt auf der Webseite der Piratenpartei das Wahlprogramm als HTML-Dokument, als PDF Version in leichter Sprache, im ePub-Format, und in verschiedenen Audioformaten vor.
Das Front-Cover des Programms zeichnet sich farblich durch einen orangefarbenen Grundton und der zum Teil blau hinterlegten Überschrift aus. Das Logo der Partei steht tendenziell im Hintergrund und auch der Name der Partei selbst hat eher untergeordneten visuellen Status. Insgesamt macht das Cover einen frischen, aber keineswegs unangepassten Eindruck.
Der eigentliche Text des Wahlprogramms beinhaltet wenige auffällige Stilelemente, lediglich der Einsatz von Fotos vor jedem Kapitel fällt in dieser Hinsicht auf. Diese scheinen sich alle auf eigene parteipolitische Veranstaltungen zu beziehen. Weiterhin ist auffällig, dass auf semantischem Wege eine Verbindung von Partei und Wählern hergestellt werden soll (z.B. „unserer Bürger- und Freiheitsrechte“, S.152). Das Programm selbst besteht aus 12 Kapiteln, denen eine knapp einseitige Einleitung vom Parteivorsitzenden Bernd Schlömer (der im Übrigen qua Ausbildung am IKS Kriminologe ist) voransteht. Dort schreibt er, dass es das Ziel der Partei sei, in den Bundestag einzuziehen und dass die Piraten „(ändern) wollen, wie Politik gemacht wird und so auch die Politik selbst“ (S. 7). Einen konkreten kriminalpolitischen Bezug findet man in dieser Einleitung nicht, lediglich der Hinweis, dass die Piratenpartei für eine „solidarische, lebenswerte Gesellschaft“ (ebd.) steht, lässt erste entsprechende inhaltliche Tendenzen erahnen.
 Die Überschriften der Hauptkapitel lauten wie folgt:
Die Überschriften der Hauptkapitel lauten wie folgt:
- Freiheit und Grundrechte
- Demokratie wagen
- Internet, Netzpolitik und Artverwandtes
- Bildung und Forschung
- Umwelt und Verbraucherschutz
- Kunst und Kultur
- Arbeit und Soziales
- Familie und Gesellschaft
- Gesundheit
- Europa
- Aussenpolitik
- Wirtschaft und Finanzen
- Innen- und Rechtspolitik
Die kriminal- und sicherheitspolitischen Inhalte finden sich unter dem Punkt ‚Innen- und Rechtspolitik‘. Weitere einschlägige Themen finden sich im Auftaktkapitel (‚Freiheit und Grundrechte‘), wo z.B. die Forderung der Partei zur „Stärkung der Rechte Prostituierter“ und die Stellung der Partei zu Pyrotechnik zu erschließen sind und im Kapitel zur „Aussenpolitik“ [sic!].
Wortzählung
Die nachfolgende Auszählung von Schlagworten mit kriminal- und sicherpolitischer Konnotation im Wahlprogramm der Piratenpartei dient einer ersten Annäherung an dessen inhaltliche Ausrichtung. Die Darstellung der Häufigkeiten der Schlagworte bezieht sich jeweils auf den Wortstamm (d.h. Terror umfasst ebenfalls terroristisch, Terrorismus, Terrorismusabwehr etc.).
| Thema | Anzahl der Wörter |
| Freiheit | 52 |
| Sicherheit | 50 |
| Gefahr | 11 |
| Terror, Terrorismus, o.ä. | 2 |
| Bekämpfung | 9 |
| Krieg | 3 |
| Kriminalität | 8 |
| Verbrechen | 1 |
| Straftäter | – |
| kriminell | 3 |
| Droge | 23 |
| Datenschutz | 33 |
| Gesetz, gesetzlich | 44 |
| Verbot | 23 |
| Überwachung | 39 |
Kriminal- und Sicherheitspolitische Positionen
Die kriminalpolitischen Positionen der Piratenpartei werden vor allem auf den Seiten 152-157 dargestellt. Unter der Überschrift „Innere Sicherheit“ und dem Schlagwort „Sicherheit in Freiheit“ heißt es dort einleitend:
Bewahrung und Ausbau unserer Bürger- und Freiheitsrechte sind für uns zentrale politische Herausforderungen. Die steigende Zahl von Überwachungsgesetzen und Überwachungsmaßnahmen unter Verweis auf den „internationalen Terrorismus“ und andere „Bedrohungen“, der mangelnde Bestand solcher Gesetze vor der Verfassung, die teils für rechtswidrig erklärten Maßnahmen gegen politischen Protest und die wiederkehrenden Skandale bei deutschen Geheimdiensten belegen gravierenden Handlungsbedarf. (S. 152)
Die weiteren kriminal- und sicherheitspolitischen Positionen und Forderungen lauten wie folgt:
Nationale Kriminalpräventionsstrategie (S. 152):
- Förderung von Kriminalpräventionsmaßnahmen, die – anders als z.B. Überwachungsmaßnahmen – in ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich bestätigt sind.
- Der Fokus richtet sich auf Kinder und Jugendliche.
- Ziel: eine nationale Präventionsstrategie.
Sicherheitsbewusstsein stärken (S. 152):
- Die gefühlte Sicherheit ist ein wichtiger Faktor für das persönliche Wohlbefinden und sollte deshalb gestärkt werden.
- Das heißt, dass der in der Allgemeinheit vorzufindenden Tendenz, Kriminalitätsrisiken zu überschätzen und sich gleichsam unnötig unsicher zu fühlen, entgegnet werden muss.
- Ziel: Programm zur Stärkung des Sicherheitsbewusstseins und zur sachlichen Information über Kriminalität in Deutschland.
Systematische Evaluierung von Überwachungsbefugnissen und -programmen (S. 152f):
Vor Kriminalität zu schützen ist eine wichtige staatliche Aufgabe. Sie kann nach unserer Überzeugung nur durch eine intelligente, rationale und evidenzbasierte Sicherheitspolitik auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse erfüllt werden. Um kluge Sicherheitsmaßnahmen fördern und schädliche Maßnahmen beenden zu können, wollen wir, dass eine dem Bundestag unterstellte Deutsche Grundrechteagentur alle 153 bestehenden und neu zu schaffenden Befugnisse und Programme der Sicherheitsbehörden systematisch und nach wissenschaftlichen Kriterien auf ihre Wirksamkeit, Kosten, schädlichen Nebenwirkungen, auf Alternativen und auf ihre Vereinbarkeit mit unseren Grundrechten untersucht (systematische Evaluierung). Auf dieser Grundlage können wir sodann Grundrechtseingriffe aufheben oder verhindern, wo dies ohne Einbußen an Sicherheit – also ohne Einfluss auf die Kriminalitätsrate – möglich ist oder wo sich der Eingriff als unverhältnismäßig erweist. Wir wollen auch auf Maßnahmen verzichten, deren Effizienz so gering ist, dass die dadurch gebundenen Mittel an anderer Stelle mehr zu unserer Sicherheit beitragen können.
Privatsphäre rechtstreuer Bürger achten (S. 153):
- Ziel ist die „Bewahrung unseres historischen Erbes an Freiheitsrechten“ und die „Sicherung der Effektivität der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung“.
- Die staatliche Informationssammlung sollte nur noch gezielt bei Personen erfolgen, „die der Begehung oder Vorbereitung einer Straftat konkret verdächtig sind“.
- Gefordert wird der Verzicht auf „anlasslose, massenhafte, automatisierte Datenerhebungen, Datenabgleichungen und Datenspeicherungen“, da eine entsprechende Praxis in einem „freiheitlichen Rechtsstaat (…) nicht hinnehmbar und schädlich ist“.
Freiheitspaket verabschieden (S. 153):
- „Unnötige und exzessive Überwachungsgesetze der letzten Jahre wollen wir mit einem „Freiheitspaket“ wieder aufheben“.
Dazu zählen:- die Übertragung exekutiver Polizeibefugnisse einschließlich Online-Durchsuchung auf das Bundeskriminalamt,
- gemeinsame Dateien von Polizeien und Geheimdiensten, die flächendeckende Erhebung biometrischer Daten sowie deren Speicherung in RFID-Ausweisdokumenten,
- die lebenslängliche Steuer-Identifikationsnummer,das elektronische Bankkontenverzeichnis,
- die verpflichtende elektronische Gesundheitskarte,
- die Überwachung von Wohnungen, von Ärzten, Rechtsanwälten, Geistlichen, Abgeordneten und anderen Vertrauenspersonen,
- den Identifizierungszwang für Handy- und Internetnutzer,
- das Verbot anonymen elektronischen Bargeldes (Zahlungskarten) über 100 Euro sowie die Auslieferung von Personendaten an die USA und andere Staaten ohne wirksamen Grundrechtsschutz.
Neue Überwachungspläne stoppen (S. 153f):
- Gefordert wird ein Moratorium, welches sich mit Grundrechtseingriffen im Namen der Kriminalitätsbekämpfung auseinandersetzt.
Dazu zählen vor allem:- eine flächendeckende Protokollierung aller unserer Telefon- oder Internetverbindungen (Vorratsdatenspeicherung) gleich für welche Dauer,
- eine Vorratsspeicherung von Flug-, Schiff- und sonstigen Passagierdaten,
- eine systematische Überwachung des Zahlungsverkehrs oder sonstige Massendatenanalyse (Stockholmer Programm der EU),
- den Einsatz von Überwachungsdrohnen sowie
- den Einsatz von Rasterfahndungs-Software in Online-Netzwerken.
Grundrechtskonformität der Gesetzgebung stärken (S. 154):
- Einem Drittel des Deutschen Bundestages oder zwei Fraktionen soll das Recht eingeräumt werden, Rechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungskonformität eines Gesetzesvorhabens einzuholen.
- Der Bundespräsident soll die Befugnis erhalten, bei verfassungsrechtlichen Zweifeln vor der Ausfertigung eines Gesetzes das Bundesverfassungsgericht anzurufen.
- Bürgerrechtsorganisationen soll die Möglichkeit eröffnet werden, stellvertretend für die Allgemeinheit vor den Fachgerichten und dem Bundesverfassungsgericht gegen Grundrechtsverletzungen zu klagen.
Sicherheitsforschung demokratisieren (S. 154):
- Jene Sicherheitsforschung, die aus Steuergeldern finanziert wird, soll demokratisiert und an den Bedürfnissen und Rechten der Bürgerinnen und Bürgern2 ausgerichtet werden.
- Beratende Gremien sollen in Zukunft neben Verwaltungs- und Industrievertretern auch mit Mitgliedern sämtlicher Fraktionen, Kriminologen, Opferverbände und Nichtregierungsorganisationen besetzt werden.
- Die Ausschreibung eines entsprechenden Projekts soll erst vollzogen werden, wenn eine öffentliche Untersuchung über die Auswirkungen des jeweiligen Forschungsziels auf unsere Grundrechte (impact assessment) vorliegt.
- Neue Entwicklungen von Überwachungstechnologien werden grundsätzlich abgelehnt. Die Sicherheitsforschung sollte sich stattdessen auf die Präventionsmöglichkeiten von Kriminalität konzentrieren.
Dem ersten Teil des Kapitels ‚Innere Sicherheit‘, der unter dem Titel „Sicherheit in Freiheit“ firmiert, folgt ein zweiter Teil, der mit „Strafrechtsreform durch Prävention und Entkriminalisierung“ betitelt ist (S. 154f). Die dort explizierten Punkte werden im folgenden zusammengefasst:
Evaluation vergangener Strafrechtsreformen (S. 154f):
- Die Strafrechtspolitik der vergangenen Jahre zeichnet sich durch „blinden Aktionismus“ aus, der aus der medialen Thematisierung spektakulärer Einzelfälle folgt und Kriminalisierungs- und Strafverschärfungsprozesse beinhaltet.
- Stattdessen soll das Strafrecht „wieder sinnvoll“ weiterentwickelt werden, indem auf wissenschaftliche Untersuchungen zurückgegriffen wird.
- Als „leitender Maßstab“ fungiert dabei der Imperativ, „dass so wenig wie möglich in das grundlegende Recht aller Menschen auf Freiheit eingegriffen werden soll“.
- Daraus folgt: „Haftstrafen sollen nur für solche Fälle vorgesehen werden, wo dies aufgrund der Schwere der Tat und dem Ausmaß der Schuld des Täters angemessen ist“.
Schwerpunkt muss die Verhinderung von Straftaten sein und nicht die Bestrafung (S. 155):
- Das Paradoxon, dass dem Gefängnis als Resozialisierungsinstitution anhaftet, scheint auch den Piraten nicht verborgen geblieben zu sein:
Zwar kann jemand, der im Gefängnis ist, zunächst einmal keine weiteren Straftaten begehen, aber dort kommt er mit anderen Personen zusammen, die ebenfalls Straftaten begangen haben und denen er sich dann zugehörig fühlt. Erst durch die Bestrafung fühlen sich die Täterin oder der Täter als Kriminelle oder Krimineller abgestempelt und verhalten sich nach der Haftentlassung auch entsprechend. In der Haft haben die Gefangenen zudem viel Zeit, sich gegenseitig Fähigkeiten beizubringen, die sie nach Ende der Haft für weitere Straftaten nutzen können.
- Zwar wird die gesellschaftliche Integration als „beste kriminalpräventive Maßnahme“ gehalten, doch auch „andere Maßnahmen, die sich stärker an besonders gefährdeten Personengruppen, zum Beispiel Vorbestrafte oder bestimmte Milieus, wenden“, sollen gefördert werden.
Überprüfung aller Straftatbestände unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten (S. 155f):
- „Um eine kontraproduktive Stigmatisierung durch Strafe generell zu verhindern, wollen wir alle Straftatbestände dahingehend überprüfen, ob sie sinnvoll und erforderlich sind“.
- Angemerkt wird, wie teuer es dem Steuerzahler kommt, einen Haftplatz zu finanzieren. Dem wird gegeübergestellt, dass ein Schwarzfahrer lediglich „ein paar Euro Schaden verursacht“ und gefragt, ob sich das rechnen würde.
- Der konkrete Vorschlag lautet: „Heutige Straftatbestände, die nicht strafwürdiges Verhalten unter Strafe stellen, sollen zu Ordnungswidrigkeiten oder Antragsdelikten herabgestuft, im Strafrahmen gesenkt oder gänzlich straffrei gestellt werden“.
Strafrecht muss dem realen Rechtsgüterschutz dienen (S. 156):
- Als strafwürdig werden nur solche Handlungen erachtet, „die individuelle Rechtsgüter anderer Menschen, wie zum Beispiel Leben, Gesundheit oder Eigentum, verletzen oder erheblich gefährden“.
- Demgegenüber sollen „(r)ein abstrakte Gefährdungsdelikte“ daraufhin analysiert werden, ob individuelle Rechtsgüter gefährdet sind, eine Gefährdung bewiesen ist und die Gefährdung ein nennenswertes Ausmaß erreicht. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, sollte im Einzelfall über eine Entkriminalisierung nachgedacht werden.
- Verbrechen ohne Opfer (z.B. „Besitz und Kauf von Drogen durch volljährige Konsumenten“), sollten straffrei sein, da es nicht die Aufgabe des Strafrechts ist, „mündige Bürgerinnen und Bürger vor sich selbst zu schützen“.
Keine Bestrafung bei nur geringem Unrechtsgehalt (S. 156):
- Bei bestimmten Taten, die nur einen sehr kleinen Schaden zur Folge haben und nicht sozialschädlich sind, soll überprüft werden, ob sie straffrei bleiben sollen (z.B. „Containern bzw. „Mülltauchen“).
- Als nicht sozialschädlich wird auch das sogenannte „White-Hat-Hacking“ begriffen, bei dem Hackende ohne Beauftragung testen, ob Firmen oder Behörden Sicherheitslücken in ihrem Computernetzwerk haben und diese bei Entdecken solcher Lücken darüber informieren. Gleiches gilt laut Piraten für das Whistleblowing.3
Abschaffung von bloßem Moralstrafrecht (S. 156f):
- Laut Piraten muss die Frage gestellt werden, ob ein Staat das Recht hat, Verhaltensweisen unter Strafe zu stellen, die kein Rechtsgut anderer verletzen, um damit bestimmte Moralvorstellungen durchzusetzen (Beispiele: §§ 173 und 184 StGB, die den Beischlaf zwischen einwilligungsfähigen volljährigen Verwandten und die Verbreitung pornografischer Schriften, und sei es nur durch den Versand an einen willigen Empfänger, unter Strafe stellen.
- Als „diskriminierend“ und entsprechend revisionsbedürftig wird ferner der § 183 StGB, der nur exhibitionistische Handlungen von Männern, nicht aber von Frauen und „„transsexuellen Eichhörnchen““ unter Strafe stellt, begriffen.
Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Rechtsstaats (S. 157):
- Da Deutschland grundsätzlich wehrfähig gegen Bestrebungen bleiben muss, „die sich gegen das Grundgesetz und die darin verbürgte verfassungsrechtliche Ordnung wenden“, gehören Verbote, die notwendig sind, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung und den Rechtsstaat zu verteidigen, nicht abgeschafft.
- Trotz allem soll auch hier geprüft werden, ob einzelne Bestimmungen des Strafgesetzbuches tatsächlich dazu erforderlich sind (z.B. das Verbot auf die Bundesrepublik Deutschland zu schimpfen oder die Farben, die Flagge oder die Nationalhymne Deutschlands zu verunglimpfen).
- Dabei gilt es insbesondere die Meinungs- und Kunstfreiheit stärker zu berücksichtigen.
Verhängung von Strafen muss besonders gerechtfertigt sein (S. 157):
- Als „schärfstes Mittel des Staates“ sollte das Strafrecht „nur mit Augenmaß angewendet werden“, nur als ‚ultima ratio‘ angewendet werden.
- Im besonderen die Haftstrafe, „die empfindlich in das Grundrecht des Menschen auf Freiheit seiner Person“ eingreift, bedarf einer dezidierten Rechtfertigung.
- „Als liberale Partei sollten wir an eine solche Rechtfertigung besonders strenge Maßstäbe anlegen. Hierfür wollen wir uns einsetzen.“
Kein Verkaufsverbot für Alkohol (S. 157):
- Ein nächtliches Verkaufsverbot für Alkohol lehnen die Piraten ab, da sie es für wirkungslos halten.
- Stattdessen soll die Aufklärungsarbeit über die Gefahren des Alkoholkonsums bei allen Altersgruppen gefördert werden.
Auch in den anderen Kapiteln sind vereinzeltet Verweise auf kriminal- und sicherheitspolitische Forderungen und Vorschläge zu finden. Im Folgenden sollen die relevanten Positionen aufgeführt werden:
Überwachung (S. 15ff):
- Keine Bundes- bzw. Staatstrojaner.
Asyl (S. 17ff):
- Ende von Abschiebung und Abschiebehaft.
Stärkung der Rechte Prostituierter (S. 22).
Piraten für Fanrechte (S. 23f):
- Kollektivstrafen werden abgelehnt.
Die Verfolgung und Sanktionierung von Straftaten muss im gesetzlichen Rahmen von der Polizei durchgeführt werden, statt sie in das Vereinsrecht zu verlagern, wo Mittel und Verfahren rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht genügen.
Hooligans und organisierte Gewalttäter werden durch Stadionverbote nicht von der Begehung von Straftaten außerhalb der Stadien abgehalten. Hier muss zur Gewaltprävention die Arbeit der Fanprojekte und Fanbeauftragten unterstützt werden, um zu verhindern, dass Jugendliche in die Hooliganszenen abdriften.
Position der Piratenpartei zu Pyrotechnik (S. 25):
Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, den kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik durch Fans, dort wo es die lokalen Gegebenheiten zulassen, zu ermöglichen.
Infrastruktur (S. 38ff):
Die Piratenpartei setzt sich für die vollständige Abschaffung des sogenannten „Hackerparagraphen“ § 202c StGB ein, da er für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgt und Tür und Tor für willkürliche Verfolgung im IT-Sicherheitsbereich tätiger Personen öffnet.
Migration und Inklusion (S. 99ff):
Wir brauchen eine intensivere Politik für Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufhalten, um deren Recht- und Perspektivlosigkeit zu beenden.
Drogen- und Suchtpolitik (S. 113ff):
Der private Umgang mit psychotropen Substanzen muss komplett entkriminalisiert werden. Anbau und Herstellung für den Eigenbedarf dürfen nicht bestraft werden.
Die Piratenpartei fordert als Sofortmaßnahme einen bundeseinheitlich geregelten Richtwert von 30 Gramm für den duldbaren Besitz von Cannabis zum Eigenkonsum für Volljährige, um zumindest die Kriminalisierung der Cannabis-Konsumenten zu beenden und die Behörden zu entlasten.
Wir fordern eine Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes, in der die erfassten, psychotropen Substanzen neu bewertet werden: Nur wenn eine Fremdgefährdung realistisch nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen die Freiheitsrechte des Einzelnen eingeschränkt werden.
Aussen- und Sicherheitspolitisches Programm (S. 135ff):
Die Piratenpartei setzt sich für eine globale Sicherheitspolitik ein, welche nicht nur die Symptome von Konflikten aufgreift , sondern deren Ursachen angehen möchte.
Wir bleiben einer Kultur der politischen Zurückhaltung mit militärischen Mitteln verpflichtet. Das Primat der Politik bedingt, dass der Einsatz militärischer Mittel immer nur eine letzte Option sein kann.
Die momentanen Maßnahmen gegen terroristische Bedrohungen entsprechen einer Reaktionspolitik, welche pauschal die Rechte unbescholtener Bürger beschneidet. Freiheit und Bürgerrechte geben wir aber nicht zugunsten einer unbewiesenen Verbesserung der Sicherheitslage auf. Aus Sicht der Piraten bedarf es stattdessen einer Präventionspolitik.
Politische Transparenz und Antikorruption (S. 147ff):
- Erweiterung und Verschärfung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung.
Justiz (S. 157ff) (Auswahl):
- Angemessene Ausstattung der Gerichte gewährleisten.
- Stärkung der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften.
- Umfassende Beweisverwertungsverbote.
- Stärkung der Position des Ermittlungsrichters.
- Gewährleistung einer 2. Instanz.
- Kostenerstattung bei Verfahrenseinstellung.
- Mehr Transparenz durch die Veröffentlichung aller Gerichtsentscheidungen.
- Angemessene Entschädigung zu Unrecht Inhaftierter.
Polizei (S. 164):
- Kennzeichnungspflicht für Polizisten.
- „Polizistinnen und Polizisten sind zu verpflichten, Verstöße durch andere Polizisten zu verhindern oder – falls dies nicht möglich ist – zu melden sowie den/die beteiligten Beamten zu identifizieren“.
- Keine Bundeswehreinsätze im Innern (Ausnahme: rein humanitäre Einsätze).
Fazit
Man weiß zwar nicht, in welchem Maße Parteichef Schlömer – zur Erinnerung: (Kritisch) Kriminologische Ausbildung am IKS in Hamburg – an der Formulierung des Parteiprogramms mitgewirkt hat bzw. welche Passagen er beigesteuert hat, aber käme heraus, dass er die Federführung bei der Verfassung der kriminal- und sicherheitspolitischen Positionen innehatte, kann das auf Grund seines Studienhintergrunds nicht verwundern, da nahezu alle relevanten Vorschläge, die im Wahlprogramm der Piraten bezüglich Kriminalität und Strafe expliziert werden, gleichsam eins zu eins in ein kritisch-kriminologisches Politikhandbuch – sofern es so etwas geben würde – übernommen werden könnten. Grundsätzliches Motto ist dabei die Entkriminalisierung von allerlei Verhaltensweisen und die Stärkung des Präventionsgedankens, der stets vor repressiven Maßnahmen zum Zuge kommen sollte. Indes werden die Verfasser des Programms nur an wenigen Stellen konkret und nennen handfeste Vorschläge für die wirksame Prävention von als kriminell definierter Handlungen. Wenig überzeugend sind dabei die selektiven Verweise auf wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit von bestimmten, eben am Präventionscharakter ausgerichteten Maßnahmen höher als selbige von repressiven Maßnahmen einschätzen, da es – zumindest in den meisten Fällen – stets eine Gegenstudie gibt. Grundsätzlich findet sich auch hier die gängige, wahrscheinlich in jedem der hier vorgestellten Parteiprogramme zu findende Strategie des steten Verharrens auf abstrakter inhaltlicher Ebene und des Meidens der Präsentation von handfesten Vorschlägen, bei gleichzeitiger Ignoranz potentieller Gegenargumente.
Alle im Folgenden getätigten Verweise beziehen sich auf dieses Dokument ↩
Als bemerkenswerte Randnotiz scheint mir, dass die Piraten in ihrem Programm davon absehen, auf das generische Maskulinum zu verzichten. ↩
Als Whistleblower werden dabei „Personen“ verstanden, „die auf Missstände aufmerksam machen“. ↩