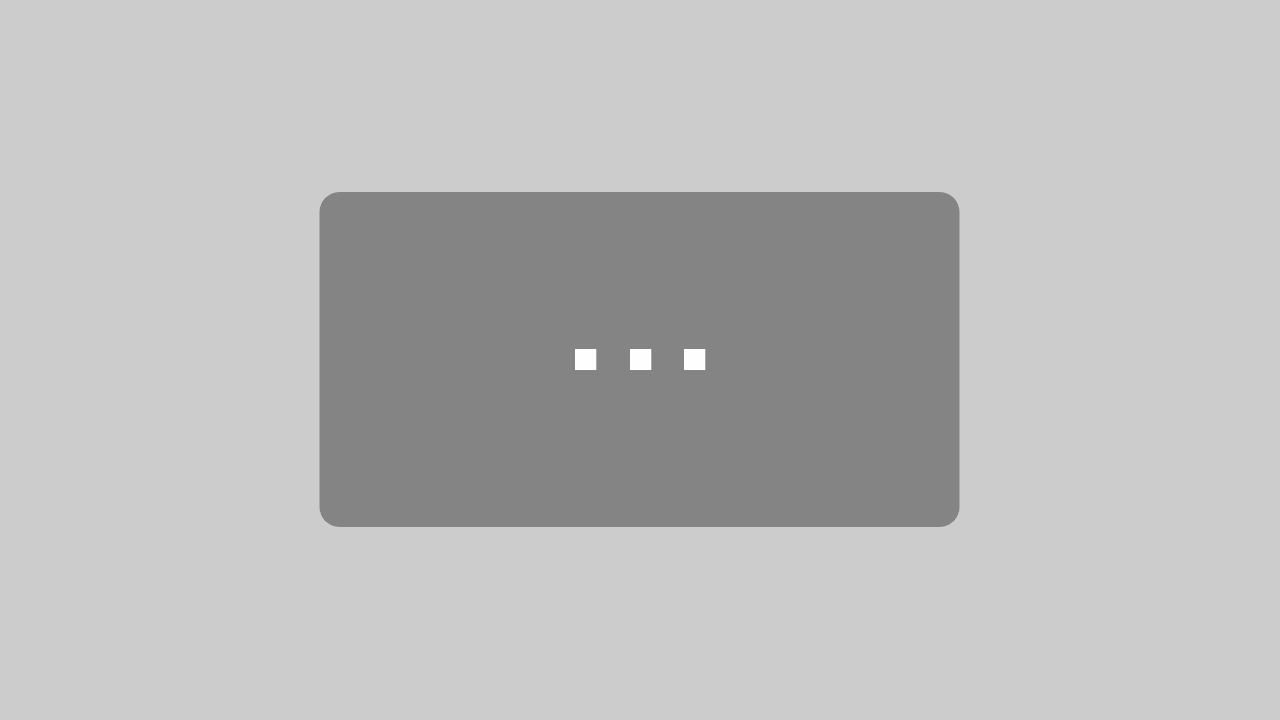In dem vorliegenden Beitrag soll eine vergleichende Analyse zweier Musikvideos vorgenommen werden. Es handelt sich dabei um zwei Versionen des Songs „Candy Shop“, zum einen das Original des Interpreten 50 Cent aus dem Jahr 2005, zum anderen um die Coverversion der Band The Baseballs von 2011. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei auf den visuellen Elementen der Musikvideos.1
50 Cent featuring Olivia – Candy Shop (2005)
The Baseballs – Candy Shop (2011)
Der Text des Originalsongs wurde für die Coverversion nicht verändert. Daher ist er für eine vergleichende Analyse nicht aussagekräftig. Allerdings stellt der Text natürlich eine wichtige Ebene innerhalb eines Musikvideos dar, weswegen er dennoch nicht gänzlich vernachlässigt werden sollte. Der Text lautet2:
I’ll take you to the candy shop
I’ll let you lick the lollipop
Go ‚head girl, don’t you stop
Keep goin ‚til you hit the spot (whoa)
I’ll take you to the candy shop
Boy one taste of what I got
I’ll have you spending all you got
Keep going ‚til you hit the spot (whoa)You can have it your way, how do you want it
You gon‘ back that thing up or should I push up on it
Temperature risin, okay let’s go to the next level
Dance floor jam packed, hot as a tea kettle
I’ll break it down for you now, baby it’s simple
If you be a nympho, I’ll be a nypmho
In the hotel or in the back of the rental,
On the beach or in the park, it’s whatever you into
Got the magic stick, I’m the love doctor
Have your friends teasin‘ you ‚bout how sprung I gotcha
Wanna show me how you work it baby, no problem
Get on top then get to bouncing round like a low rider
I’m a seasoned vet when it come to this shit
After you work up a sweat you can play with the stick
I’m tryin to explain baby the best way I can
I melt in your mouth girl, not in your hands (ha ha)3I’ll take you to the candy shop
I’ll let you lick the lollipop
Go ‚head girl, don’t you stop
Keep goin ‚til you hit the spot (whoa)I’ll take you to the candy shop
With one taste of what I got
I’ll have you spending all you got
Keep going ‚til you hit the spot (whoa)Girl what we do (what we do)
And where we do (and where we do)
The things we do (things we do)
Are just between me and you (oh yeah)Give it to me baby, nice and slow
Climb on top, ride like you in the rodeo
You ain’t never heard a sound like this before
‚Cause I ain’t never put it down like this
Soon as I come through the door she get to pullin‘ on my zipper
It’s like it’s a race who can get undressed quicker
Isn’t it ironic how erotic it is to watch her in thongs
Had me thinking ‚bout that ass after I’m gone
I touch the right spot at the right time
Lights on or lights off, she like it from behind
So seductive, you should see the way she winds
Her hips in slow-mo on the floor when we grind
As long as she ain’t stoppin, homie I ain’t stoppin‘
Drippin‘ wet with sweat man it’s on and popping
All my champagne campaign, bottle after bottle it’s on
And we gon‘ sip til every bubble in the bottle is goneI’ll take you to the candy shop
I’ll let you lick the lollipop
Go ‚head girl, don’t you stop
Keep goin ‚til you hit the spot (whoa)I’ll take you to the candy shop
Boy one taste of what I got
I’ll have you spending all you got
Keep going ‚til you hit the spot (whoa)I’ll take you to the candy shop
I’ll let you lick the lollipop
Go ‚head girl, don’t you stop
Keep goin ‚til you hit the spot (whoa)I’ll take you to the candy shop
Boy one taste of what I got
I’ll have you spending all you got
Keep going ‚til you hit the spot (whoa)
Die Message des Textes ist nicht besonders subtil, weswegen auf eine langwierige Exegese verzichtet werden kann. Um es mit den Worten eines Users einer Seite für Interpretationen von Songtexten auszudrücken: „Yeah, like most highly commercial rap songs, no explanation is needed.“4
Die Originalversion des Songs ist dem Genre Rap/Hip Hop zuzuordnen.
Die Coverversion gehört zum Genre Rock’n’Roll/Rockabilly.5 Sowohl der Sound als auch der Rhythmus sind im klassischen Rock’n’Roll Stil der 50er Jahre gehalten.
Analyse der Originalversion: 50 Cent featuring Olivia – Candy Shop (2005)
Das Musikvideo zum Originalsong beginnt damit, dass ein roter Sportwagen auf das Grundstück einer großen Villa einbiegt. Als nächstes entsteigt dem Auto der Interpret des Songs, 50 Cent, in genretypischer Kleidung. Er begibt sich dann in die Villa, in der eine Gruppe leicht bekleideter Damen ihn empfängt. Der Rest des Videos besteht aus einer Abfolge von Varianten dreier Themen. Abwechselnd zeigt sich der Interpret allein, bei sexuellen Kontakten mit einer der Damen oder aber es werden die Frauen beim Tanzen und performen gezeigt. Das Ende des Videos offenbart, dass es sich bei dem bis dato Gesehenen um einen Traum gehandelt hat. Der Interpret wird im Drive-in einer Fastfood-Kette von einer Mitarbeiterin des Unternehmens geweckt, die die Hauptperson in seinem abrupt beendeten Traum dargestellt hat.
Resümierend lässt sich zur Version von 50 Cent sagen:
Text, Bild und Musik des Songs sind entlang des zugehörigen Videoclips schnell beschrieben: die topologische Selbstinszenierung des Stars als sexuell potenter »african-american hero«, von süßen Nymphen umschwärmt: »Yeah… / Uh huh / So seductive«. Die luxuriöse Villa als Schauplatz nächtlicher erotischer Szenen und obszöner Doppeldeutigkeiten: »Got the magic stick, I’m the love doctor […] / I melt in your mouth girl, not in your hands (haha)«. Fließende Zuckerströme, geheimnisvolle Verwandlungen und Schnitte, die den Rapper immer wieder aus den Armen der jungen Frauen samt ihrer wunderbaren Sirupwelt reißen. Das Pendeln zwischen Akteurs- und Voyeurs-Perspektive: »Lights on or lights off, she likes it from behind / So seductive, you should see the way she wind / Her hips in slow-mo on the floor when we grind«. Und das prosaische Ende, als plötzliches Erwachen in eine reichlich öde Fast-Food-Realität inszeniert.
(Bielefeldt 2006: 149)
Das Video zum Originalsong ist auf der visuellen Ebene ähnlich explizit wie bereits auf der textuellen Ebene. Die mit freizügig gekleideten Damen gefüllte Villa gleicht einem Bordell, in dem der Interpret nach Lust und Laune mit der jeweiligen Dame seiner Wahl seinen sexuellen Fantasien freien Lauf lassen kann – und sich wie ein Junge im Candy Shop von den angebotenen Köstlichkeit verführen lässt. Die Atmosphäre des Clips ist eher düster. Die Frauen erscheinen als willige Sexobjekte, während in der Darstellung des Interpreten viele Elemente eines typischen Rapvideos zu finden sind: teure Autos, Goldschmuck und andere Insignien materiellen Wohlstands sowie Frauen als verfügbare Sexobjekte.
Analyse der Coverversion: The Baseballs – Candy Shop (2011)
Das Musikvideo der Coverversion ist passend zur musikalischen Ausrichtung komplett im Stil der 50er Jahre gehalten. Die Orientierung an den 50ern zeigt sich vor allem im Styling der Protagonisten und in den zu sehenden Gegenständen (vgl. El-Nawab 2007: 293 ff.) .6 Es beginnt damit, dass der Zeit gemäße Autos in ein Autokino einfahren. Auf der Leinwand ist dann der eigentliche Clip zu sehen. Er spielt am Strand, wo die Interpreten aus Surfbrettern einen Verkaufsstand für Süßigkeiten zusammenzimmern, wobei sie von einer ganzen Schar Damen beobachtet und bewundert werden. Dieser Erzählstrang wird gelegentlich durchbrochen: zum einen durch Szenen, die sich im Autokino abspielen, zum anderen durch Sequenzen, in denen die Interpreten beim Performen des Songs am Strand / an einem Rettungsschwimmerhäuschen am Strand zu sehen sind.
Das Video der Coverversion wirkt im Vergleich zur Originalversion wesentlich züchtiger und anständiger. Zwar ist auch hier eine ganze Schar an leicht bekleideten Frauen zu sehen. Da jedoch das Setting nicht – wie im Original – eine düstere Villa bei Nacht, sondern ein Strand bei strahlendem Sonnenschein ist, wirkt die spärliche Bekleidung weniger sexuell aufgeladen. Während im Videoclip zum Original die Textstelle mit dem Lollipop – zumindest teilweise – durch eine deiktische Geste in Richtung des männlichen Geschlechtsteils unterstrichen wird (0:42), werden beim Video zur Coverversion tatsächlich Lollipops an die Damen verteilt. Auch dadurch wirkt das Video deutlich weniger sexuell explizit als das Original.
Vergleichende Analyse – O tempora, o mores7
Auf den ersten Blick zeigt der Vergleich der beiden Videos also, dass es in ersterem vor allem um Sex geht, wobei die Frauen als willige Sexobjekte dargestellt werden. Letzteres Video hingegen wirkt durch den 50er Jahre Stil – aus heutiger Perspektive betrachtet – deutlich zurückhaltender und anständiger. Würde man allerdings den moralischen Maßstab der 50er Jahre an das Video anlegen, so wäre das Ergebnis vergleichbar mit dem, was das Originalvideo in der heutigen Zeit bedeutet.8
In den Videos werden – beinahe archetypisch – zwei Subkulturen dargestellt, die trotz anfänglich starker Diskrepanz eine Vielzahl an Parallelen aufweisen, zumindest dann, wenn man sie in ihrem jeweiligen zeithistorischen Kontext betrachtet. Denn
popular forms of music contain significant cultural traditions that cannot be severed from the socio-historical moment in which they take place
(Rose 1994, zitiert nach Kubrin 2005: 365).
Bei 50 Cent handelt es sich um den Archetyp des (Gangsta) Rap, wie er von Kubrin (2005) unter Rückgriff auf Andersons Code of the Street (1999) 9 beschrieben wird. Neben den zentralen Elementen von Respekt und Gewalt gehören dazu
the appreciation for material wealth as another way to establish self-image and gain respect. Nice cars, expensive jewelry, and the latest clothing fashions not only reflect one`s style, but also demonstrate a willingness to possess things that may require defending. Likewise, respect and recognition are gained through sexual promiscuity and conquest. For young men, sex is considered an important symbol of social status, which results in the objectification of women. The more women with whom a young man has sex, the more esteem he accrues
(Kubrin 2005: 364 f.).
50 Cent selbst scheint den Song allerdings für nicht besonders sexlastig und obszön zu halten. Er äußerte diesbezüglich in einem Interview mit MTV: „I attempted to be as sexual as possible, from a male perspective, without being vulgar or obscene. I think that I did a great job on it.”10
Bei The Baseballs handelt es sich um eine moderne Version des Archetyps des Rock’n’Roll, der auch als Neo-Rockabilly bezeichnet werden kann.
Rock’n’Roll ist der Dreh- und Angelpunkt der Szene. In den 50er Jahren hatte diese Musik eine revolutionäre Wirkung, die der damaligen Jugend half, sich zumindest in ihrer Freizeit von der Steifheit und den Zwängen der Erwachsenenwelt zu befreien. Die Mischung von schwarzer und weißer Musikkultur, die an Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug und Gesang erzeugt wird, hat viele Facetten. […] Die Texte handeln in der Regel vom Rock’n’Roll, Tanzen, Party-Machen, Liebe, schönen Frauen, Autos und Nonsense. Besonders tiefgründig sind die Texte nur selten.
(El-Nawab 2007: 301)
Im Video zeigt sich auch das am Geschlechterverhältnis der 50er Jahre orientierte Verhältnis zwischen Männern und Frauen. „Ein zentrales Merkmal der Rockabilly-Subkultur ist die Inszenierung eines extremen Gehabes ‚Harte Kerle vs. Weiblichkeit‘. Davon lebt die Szene“ (El-Nawab 2007: 311). So werden die Frauen im Clip wie kleine Mädchen dargestellt, die an ihren Lollis lutschen und sich auf der Schaukel von den starken Männern anschubsen lassen.11
Anders als 50 Cent sind The Baseballs selbst der Ansicht, dass es sich bei „Candy Shop“ um einen – im Vergleich zum restlichen Repertoire der Band – eher anstößigen Song handelt, was aus einem Interview der Badischen Zeitung mit der Band hervorgeht.
BZ: Warum heißt Ihre neue Platte ‚Strings ’n’ Stripes‘?
Digger: Sie ist benannt nach Stars ’n’ Stripes, der amerikanischen Flagge.
BZ: Und die ‚Strings‘, ist das anzüglich?
Digger: Wir meinen natürlich Gitarrensaiten. Aber meine Mutter fragte natürlich gleich, ob wir denn jetzt auch verruchtere Sachen machen. (Alle lachen.) Meine Eltern sind an sich sehr locker – bis sie den Text von ‚Candy Shop‘ gehört haben…12

Ein versteckter Hinweis auf die Anstößigkeit ist auch im Video selbst zu finden. So bleibt am Anfang (00:20) ein Auto so vor einem Plakat stehen, dass von dem eigentlichen Schriftzug „free popcorn“ nur noch „free porn“ zu lesen ist.
Im Video zeigt sich also die für die Rockabilly-Subkultur charakteristische Ambivalenz,
ihre widersprüchliche Position zwischen Rebellion und Konservatismus. […] In ihrem Selbstverständnis als Rebellen orientieren sich Rockabillies an dem Aufbegehren ‚der Jugend‘ gegen die Moral und Sittsamkeit der Erwachsenen in den 50er Jahren. Während aber ihre ‚Vorfahren‘ modern sein wollten, pflegen Rockabillies der verschiedenen Revivalgenerationen einen Konservatismus
(El-Nawab 2007: 327; vgl. Wicke 1987: 7).13
Nur vor diesem Hintergrund offenbart sich der ironische Kunstgriff der Rockabilly-Coverversion: Die sexuellen Metaphern und Analogien des Originalliedes werden durch die wortwörtliche Interpretation (I’ll take you to the candy shop, I’ll let you lick the lollipop) und die Wahl des 50er Jahre Settings verharmlost. Diese ironische Brechung findet ihren Höhepunkt, wenn am Ende des Videoclips eine weibliche (!) Autoritätsperson dem ausgelassenen Treiben am Strand ein Ende setzt.
Die Gemeinsamkeiten der zwei Subkulturen, die in den verschiedenen Versionen von „Candy Shop“ dargestellt werden, sind:
- der Ursprung der Musik in der afro-amerikanischen Unterschicht (vgl. Kubrin 2005: 361 ff., vgl. El-Nawab 2007: 235 ff.; vgl. Katzlinger 2006: 32 ff., vgl. Wicke 1987)
- das Interesse an Provokation und Rebellion gegen bestehende gesellschaftliche Verhältnisse und Werte (vgl. Kubrin 2005; vgl. El-Nawab 2007: 235 ff., vgl. Wicke 1987)
- Art der Statussymbole: Autos, Kleidung, Schmuck bzw. Frisur (als eine Art Körperschmuck bei den Rockabillies), schöne Frauen14 (Frauen als Objekte / schmückendes Beiwerk) (vgl. Kubrin 2005; El-Nawab 2007: 235 ff.)
- starke Betonung von Männlichkeit15 & Inszenierung als „harter Kerl“ durch Gewaltaffinität und Machoposen (vgl. Kubrin 2005; El-Nawab 2007: 235 ff.)
- Einstufung durch die restliche Gesellschaft als unsittlich, anstößig, provokant, primitiv und jugendgefährdend? Sorge um Moral und Sitte, Angst vor Verfall der Werte
Die ironische Brechung der Coverversion spielt geschickt mit Erwartungshaltungen der Rezipienten eines Musikgenres und offenbart zugleich einen augenzwinkernden Blick auf den gesellschaftlich Wandel von Sitte und Werte.
Quellen
Monographien und Beiträge aus Sammelbänden:
Bielefeldt, Christian (2006): HipHop im Candyshop. Überlegungen zur populären Stimme. In: Beiträge zur Popularmusikforschung. Bd. 34, S. 135-152. Online verfügbar unter: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2010/7562/pdf/Popularmusikforschung_34_S135_152.pdf, letzter Zugriff: 14.07.2013.
El-Nawab, Susanne (2007): Skinheads, Gothics, Rockabillies: Gewalt, Tod und Rock’n’Roll. Eine ethnographische Studie zur Ästhetik von jugendlichen Subkulturen. Berlin: Archiv der Jugendkulturen.
Jost, Christofer (2012): Zwischen den Stühlen. Populäre Musik im Schnittfeld von Musikanalyse und Kulturanalyse – Bestandsaufnahme und Ausblick. In: Kleiner, Marcus S./ Rappe, Michael (Hg.): Methoden der Populärkulturforschung. Interdisziplinäre Perspektiven auf Film, Fernsehen, Musik, Internet und Computerspiele. Berlin: Lit (Populäre Kultur und Medien, 3), S. 211–245.
Katzlinger, Martin (2006): Bedeutung der Symbole von Subkulturen am Beispiel der Rockabilly-Szene. Diplomarbeit. Online verfügbar unter: http://rockabillyburg.de/include.php?path=content/download.php&contentid=94&PHPKITSID=2b9d7f93387a5f14e6894b1d3bab010c, letzter Zugriff: 14.07.2013.
Keazor, Henry / Wübbena, Thorsten (2005): Video thrills the radio star. Musikvideos: Geschichte, Themen, Analysen. Bieledelf: transcript.
Kubrin, Charis E. (2005): Gangstas, Thugs, and Hustlas: Identity and the Code of the Street in Rap Music. In: Social Problems 52 (3), S. 360–378.
Wicke, Peter (1987): Rock Around the Clock. Der Aufbruch. In: Rockmusik. Zur Ästhetik und Soziologie eines Massenmediums. Leipzig: Reclam. Online verfügbar unter http://www2.hu-berlin.de/fpm/textpool/texte/wicke_zur-aesthetik-und-soziologie-eines-massenmediums_04.htm#a1, letzter Zugriff: 14.07.2013.
Internetquellen
Songtext
http://www.songtexte.com/songtext/50-cent/candy-shop-63d08287.html, letzter Zugriff: 09.07.2013.
Video von 50 Cent
http://www.myvideo.de/watch/7581925/50_Cent_featuring_Olivia_Candy_Shop, letzter Zugriff: 14.07.2013.
bzw. http://www.dailymotion.com/video/x2dy20_50-cent-ft-olivia-candy-shop_music#.UeKJwm3cMnI, letzter Zugriff: 14.07.2013.
Bei myvideo läuft vorher ein Werbespot, was bei dailymotion nicht der Fall ist. Allerdings ist hier die Qualität des Clips nicht so gut.
Video von The Baseballs
http://www.youtube.com/watch?v=IGDdDuLVIZc, letzter Zugriff: 14.07.2013.
Interview mit 50 Cent
http://www.mtv.com/news/articles/1496303/50-cent-renames-album-shoots-candy-clip.jhtml, letzter Zugriff: 14.07.2013.
Interview mit The Baseballs
http://www.badische-zeitung.de/rock-pop/the-baseballs-und-die-sehnsucht-nach-den-50ern–44220672.html, letzter Zugriff: 14.07.2013.
Zitat eines Users
http://www.lyricinterpretations.com/50-Cent/Candy-Shop, letzter Zugriff: 13.07.2013.
Zwar ist Jost (2012: 235) zuzustimmen, dass „eine qualitative Popularmusikforschung als desiderabel anzusehen ist, die gegenstandsadäquat, d. h. von den Medien bzw. den medialen Settings, Gattungen und Formaten her kommend, vorgeht und die in der Folge das gesamte Phänomenspektrum der Populären Musik, also die Bereiche der Klang-, Sprach-, Bild- und Gestenproduktion, im Blick behält und diesbezüglich keine wie auch immer geartete Hierarchisierung (etwa zugunsten der Klangproduktion) vornimmt.“ Eine gleichberechtigte Analyse aller dieser Ebenen ist in einem Blogpost jedoch nicht möglich. ↩
Quelle: http://www.songtexte.com/songtext/50-cent/candy-shop-63d08287.html, letzter Zugriff: 12.07.2013. ↩
Passend zum Titel des Songs wird hier auf einen Slogan aus der Werbung für M&Ms rekurriert. ↩
vgl. http://www.lyricinterpretations.com/50-Cent/Candy-Shop ↩
Da es eine Vielzahl an Subgruppen gibt, die unter dem Oberbegriff Rock’n’Roll vereint werden kann, verzichte ich – wie schon El-Nawab (2007: 291) – auf „‚Insider-Haarspaltereien‘, weil selbst die Insider davon abgenervt sind“ und verwende die Begriffe Rock’n’Roll und Rockabilly quasi gleichbedeutend. ↩
Eine Orientierung an Musikvideoclips aus den 50er Jahren ist nicht wirklich möglich, weil die (massenmediale) Videoclip-Kultur erst später einsetzte (vgl. Keazor / Wübbena (2005): 55 ff.). ↩
lat. für „Was für Zeiten! Was für Sitten!“ Marcus Tullius Cicero, Catilina I, 1, 2 (63 v. Chr.) beklagt den Verfall der Sitten. ↩
„In einer solchen Popularmusikforschung ist auch die Rekonstruktion der kulturellen Kontexte, in denen Sinnzuschreibungen an die musikalischen Wahrnehmungsangebote stattfinden, als konstitutives Moment der Analyse angelegt.“ (Jost 2012: 235). ↩
http://books.google.de/books?id=GlK6sXGrWtsC&lpg=PA3&hl=de&pg=PA3#v=onepage&q&f=false ↩
http://www.mtv.com/news/articles/1496303/50-cent-renames-album-shoots-candy-clip.jhtml ↩
Was im Video nicht zu sehen ist, aber ebenfalls einen Teil der Rockabilly-Subkultur darstellt, ist die Gewaltaffinität (vgl. El-Nawab 2007: 235 ff.). ↩
http://www.badische-zeitung.de/rock-pop/the-baseballs-und-die-sehnsucht-nach-den-50ern–44220672.html ↩
In oben bereits zitiertem Interview mit der Badischen Zeitung kommt dies ebenfalls zum Ausdruck:
BZ: Warum sehnen sich die Leute nach dieser Zeit zurück?
Sam: Heile Welt. Man verbindet nur positive Gefühle mit dieser Ära. Wenn man so Filme sieht wie ‚Zurück in die Zukunft‘ dann denkt man, das muss ja toll gewesen sein. ↩Während die Darstellung der Frauen im Rapgenre auf moderne liberale Werte hinweist, werden im Frauenbild des Rockabillygenres eher konservative Werte transportiert. Dennoch werden in beiden Genres übereinstimmend die Frauen primär als Objekte betrachtet. ↩
Im Video von The Baseballs zeigt sich dies auch deutlich in den Szenen, die im Autokino spielen. ↩